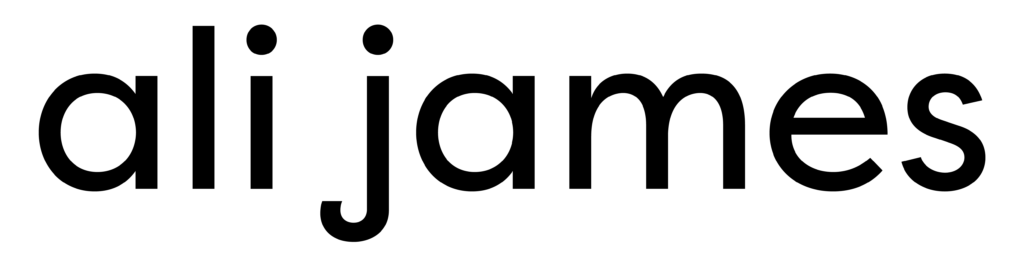Mitten in der Pandemie zu Beginn der dritten Welle, also genau dann, wenn man es eigentlich nicht tun sollte, habe ich meine Tasche gepackt und bin nach Berlin gefahren. Ich musste aus der trostlosen, bekannten Einöde raus. Mehr als zwei Monate halte ich es nie aus, ohne weg zu fahren, wenn auch nur für ein Wochenende. Es ist als würde mein Körper sein Dopamin einzig durch die langen Zugfahrten und das Schlendern durch fremde Straßen beziehen. „Dopamin vom Jetset“, habe ich mal in mein Notizbuch geschrieben, eigentlich mit der Idee einen Song so zu nennen oder es einfach als Caption unter einen meiner Instagram Beiträge zu setzen, habe ich aber nie in die Tat umgesetzt.
Der eigentliche Grund meiner Reise war aber ein anderer. Ich war dieses Mal tatsächlich auf Wohnungssuche. Einerseits aus dem einfachen Grund, dass ich eigentlich schon ewig aus dem Ruhrgebiet weg möchte, obwohl es da um einiges schöner ist als sein Ruf, andererseits weil ich mir dachte mitten in der Pandemie umzuziehen, am besten in eine Millionenstadt ist das beste was man tun kann. In diesen Zeiten, so dachte ich, müsste man nur einen kleinen Dominostein in Bewegung setzen, um etwas Großes zu erreichen, einfach weil niemand anderes sich traut diesen Stein umzuwerfen, oder weil niemand anderes auf die Idee kommt. Wenn die Welt stillsteht, braucht man sich nur bewegen, egal wie schnell, man ist automatisch schneller. Das war also mein Gedanke, mit dem ich lächelnd an einem Donnerstagmittag am Berliner Ostbahnhof ankam. Ich drehte mir eine Zigarette, ging vor den Bahnhof um festzustellen, dass es regnet, was mich ärgerte, weil die Sonne in den ICE schien, als wir noch durch Westberlin fuhren.
Die S7 fährt direkt zu meinem besten Freund Louis. Als er mir die Tür seiner WG in einem schönen Altbau in Lichtenberg öffnete, salutierte ich hastig und trat ein. Ich sah Louis sofort an, dass er länger seine Waschmaschine nicht benutzt hat; er trägt dann immer das was noch da ist, wie ein Kind welches eigentlich von seinen Eltern immer süß eingekleidet wird, aber an dem Morgen unbedingt selbst seine Kleidung aussuchen wollte. Louis öffnete mir also die Tür, wie immer mit AirPods im Ohr, und umarmte mich, während er irgendwelche wichtigen Gespräche führte, mit dem Wirtschaftsministerium oder einfach mit Luisa Neubauer, dem deutschen Gesicht der Fridays for Future Bewegung, für die Louis auch tätig ist. Er stellte sich in seiner Telefonkonferenz stumm und schlug vor, dass wir zum sudanesischen Imbiss um die Ecke gehen sollten. Ich fand die Idee gut, ich war sehr hungrig.
Die nächsten Tage waren nicht weiter spannend. Wir machten das, was man in Berlin halt macht (beziehungsweise das was man in Pandemiezeiten in Berlin machen kann). Wir schlenderten durch die Straßen, tranken Sternburg Export oder Berliner Pilsener, aßen Falafel und manch ein Abend artete völlig aus und wir landeten an irgendeinem Spreekanal in Treptow, lernten Fussballfans kennen und fotografierten uns gegenseitig, wie wir ins Wasser pinkelten. Auf dem Weg nach Hause freut man sich dann immer, dass man nachts alleine in der Bahn keine Maske tragen muss und ich forderte meine betrunkenen Freunde auf, das ikonische Bild des scheinbar verzweifelnd kurz vorm Burnout stehenden Robert Habeck in der Berliner S-Bahn, mit mir an Roberts Stelle, nachzustellen.
Da ich seit genau einem Jahr „pandemiebedingt“ (das Wort hängt mir mittlerweile bis sonstwo raus) arbeitslos bin und nur von meinem BAföG lebe, welches ich nicht einmal wirklich verdient habe, da ich nur eingeschrieben bin, um Leuten eine Antwort darauf geben zu können, was ich eigentlich mache, musste Louis sofort an mich denken, als einer seiner einflussreichen Freunde eine Aushilfe für eine Inventur suchte. Er hatte mich noch im Zug angerufen, obwohl wir uns ohnehin eine Stunde später gesehen hätten, um mich zu fragen, ob ich Interesse hätte, und ich hab natürlich sofort zugestimmt.
Das Lager, in dem diese Inventur stattfinden sollte, lag in Charlottenburg, nicht weit vom Tiergarten. Ich kam morgens an wunderschönen klassizistischen Monumenten vorbei, vor denen ich am liebsten stehen geblieben wäre, um zu salutieren, und am Landwehrkanal, bis ich in einer Straße landete, die komplett zugebaut war mit diesen modernen Bürogebäuden. Ich kann mit der Architektur der 2010er überhaupt nichts anfangen. Alles sieht gleich aus, alles sieht aus, als ob man sich da niemals nur zwei Quadratmeter leisten könnte. Die Glasfassaden der 90er und 2000er Jahre kann ich noch nachvollziehen. Wer möchte nicht einer dieser CEOs sein, die an ihrer riesigen Glasfensterfront im neunzehnten Stock stehen, auf die Metropolen dieser Welt herabschauen und eigentlich nie wieder arbeiten müssten. Obwohl auch das etwas Trostloses hat; wenn man alles erreicht hat, unfassbar viel Geld besitzt und die kleinen schönen Alltagssituationen neunzehn Stockwerke entfernt liegen, hat man sicherlich den Drang all das wieder zu erleben, am liebsten sofort, auf schnellstem Weg, durch die Glasfront nach unten.
Jene Lagerhalle, in der ich arbeiten sollte, war das kleine Gallische Dorf. Es war fast idyllisch diese paar alten Lagergebäude inmitten der grauenhaften Neubauten. Das Dorf war aber leider gefallen. Der ehemalige Besitzer, dessen Eltern das Gelände erworben hatten, als es einen Bruchteil von heute wert war, hat es verkauft, für 50 Millionen Euro an einen dieser Investoren, die aus der kleinen Idylle einen weiteren jener grässlichen Menschenkäfige machen werden, von denen es in Berlin ohnehin viel zu viele gibt.
Heinz erwartete mich auf dem Parkplatz. Ein großer, dünner, älterer Herr, lange Haare, Schnurrbart, Levis 501 kurz über der Hüfte und Wollpullover. Er sah aus als wäre er auf direktem Wege aus einem besetzten Haus im Kreuzberg der 80er zur Arbeit gekommen und er sah aus als würden wir uns bestens verstehen. Nach ein bisschen Smalltalk sind wir rüber zum Einstein, haben uns jeder einen Kaffee gekauft, mit dem wir uns ins Lager gesetzt haben. Wir haben mehrere Zigaretten geraucht, und eine Stunde lang geredet, über penibel überproduzierte Indie Musik und „rotzigen“ Rock, über den Iran und das kleine Kaff, in dem er groß geworden ist und viel über Berlin. Nur über zwei Dinge haben wir nicht geredet: Covid-19 und Politik, was aber nicht weiter schlimm war, da wir uns in den grundlegenden, in einer guten Konversation unvermeidbaren Dingen ohnehin einig waren.
Meine Arbeit bestand darin mir von Heinz Farb- und Markenbezeichnungen verschiedener Farbdosen ansagen zu lassen und diese in eine Excel-Tabelle in mein MacBook einzugeben. Die Arbeit wäre eigentlich unfassbar langweilig und fast einschläfernd gewesen, wenn ich und Heinz uns nicht so unfassbar gut verstanden hätten. In unseren langen Pausen erzählte ich von meinem präpandemischen Leben und er vom Kreuzberg der (Sie werden es nicht glauben, aber mein erster Eindruck hat genau ins Schwarze getroffen) Achtziger. Heinz erzählte wie er und eine Gruppe Punks sich mit „Poppern“ geprügelt haben, von ausschweifenden Nächten im Sound (jenes Sound in dem auch Christiane F. sich umtrieb) und wie die neue Amazon Prime Serie der Diskothek überhaupt nicht gerecht wird. Christoph, der ehemalige Besitzer des Lagergeländes, kam immer dann rein, wenn wir gerade nicht arbeiteten, setzte sich aber gerne zu uns und war eine Bereicherung für unsere guten Gespräche. Als stattlichen Mann würde man ihn wohl beschreiben; „Berliner Schnauze“ und Engelbert Strauss Arbeitskleidung prägten seine Erscheinung. Das Geld hat ihn nicht kaputt gemacht, er ist bodenständig geblieben.
Nach einigen Alkoholexzessen, die ich hier nicht näher beschreiben werde, da diese vor zwei Jahren (und hoffentlich wieder, wenn Sie diese Zeilen lesen) peinlich und traurig zugleich geklungen hätten, packe ich also wieder meine Sachen. Wenn ich nicht fast alle meine Anzughosen und schönen Rollkragenpullover mitgehabt hätte, hätte ich meinen Koffer glatt dagelassen. Als Ansporn um endlich meinen (mit Verlaub) Arsch hochzukriegen und endlich ordentlich nach einer Wohnung zu suchen, aber auch um Marlene Dietrich zu hören und mir zu denken „Ja! Ich weiß genau was Sie meinen, Frau Dietrich.“
Und so schließt sich der Kreis. Ich sitze wieder im ICE, fahre diese, mir mittlerweile viel zu bekannte Strecke und schreibe diesen Text, um zu vergessen, wie nutzlos und unfähig ich mich fühle. Das Hauptziel dieser Reise habe ich verhauen, aber zumindest schließe ich die Reise mit einem positiven Kontostand ab und sitze im gleichen Zug wie Norbert Walther-Borjans. Es ist fast traurig zu sehen, wie er reist; er stand alleine am Gleis, ganz ohne Personenschutz, ohne wichtige Telefonate, ohne Menschen, die ihn erkennen. Nur er, sein Aktenkoffer und sein iPhone 7, auf dem er wahrscheinlich gerade eine WhatsApp-Nachricht an Armin Laschet geschickt hat, um ihn mit seinem Elend zu trösten. Natürlich ist er in die erste Klasse gestiegen und trotz meiner frequentierten Besuche im Bord Bistro, die auch eine Flucht vor den nervigen Soldaten in meinem Abteil sind, sind wir uns dort bisher nicht begegnet.
Ich habe die gesamte bisherige Fahrt überlegt, ein Gespräch mit einem der Soldaten anzufangen, es sind nämlich, auch für einen Freitag, überdurchschnittlich viele, habe mich aber aufgrund des schlechten Verhaltens, welches sie an den Tag legen, und deren alternativ ausgelegte Sicht auf die, auch hier geltende, Maskenpflicht dagegen entschieden. Aus diesem Grund (und weil ich letzte Woche im Feuilleton der ZEIT einen amüsanten Kommentar darüber gelesen habe) habe ich mich gerade entschlossen einen Offenen Brief an Annegret Kramp-Karrenbauer zu schreiben. Liebe Leser, die an dieser Stelle aussteigen, ich bedanke mich für Ihre Geduld und Ihr Durchhaltevermögen. Bei Ihnen die noch weiterlesen, entschuldige ich mich vorweg für dieses schlechtrecherchierte Schriftstück, dessen Gattung ich normalerweise zutiefst verachte.
Sehr geehrte Frau Kramp-Karrenbauer,
Ich bitte sie mit diesem offenen Brief inständig, sich dafür einzusetzen, dass Ihre Soldaten ein Mindestmaß an Benehmen an den Tag legen, im ICE herrscht nunmal eine gewisse Etiquette. Ich erwarte, um Himmels Willen, keine Anstalten. Alles was ich erwarte hängt mit einem Grundverständnis gesellschaftlichen Zusammenlebens zusammen. Ich erwarte von Ihnen, Ihren Soldaten mitzuteilen, dass nicht der gesamte Zug an deren Handyvideos und Gesprächen über Handgranaten interessiert ist. Ich habe nichts gegen eine gesittete Unterhaltung, aber ich habe etwas dagegen die Gespräche ihrer Leute über Waffen mitzubekommen, was durch den räumlichen Abstand zwischen mir und jenen Soldaten sehr wohl vermeidbar gewesen wäre. Desweiteren möchte ich Ihnen nahe legen, dass das Corona-Virus auch über unsere Streitkräfte übertragbar ist und diese sich daher auch an die geltende Maskenpflicht halten sollten, wie jeder andere Fahrgast auch.
Ich hoffe meine Sorgen werden erhört und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer weiteren politischen Arbeit.
Herzlichst, Ihr Ali-James Dokoohaki